Das Phänomen Trotzphase ist gerade bei dem ersten Kind vielen unbekannt. Aber fragt man Eltern, was sie sich am meisten für ihre Kinder wünschen, wird die Mehrheit sagen: “Ich will, dass mein Kind glücklich ist”.
Eltern wollen auch, dass ihre Kinder sicher und widerstandsfähig sind, denn nicht alle Menschen sind immer nett. Eltern wissen auch, dass um wirklich erfolgreich im Leben zu sein – was auch immer Ihre Kinder tun und sein wollen – bestimmte emotionale Fähigkeiten entwickelt werden müssen.
Sie werden auch sagen, dass sie wollen, dass ihre Kinder freundlich, fürsorglich, respektvoll und zu guter Letzt auch erfolgreich und intelligent sind. Das sind alles Werte, die die meisten von uns teilen. Wer würde nicht wollen, dass sein Kind so aufwächst, dass es freundlich, fürsorglich, erfolgreich und glücklich ist?
Aber können wir unsere Kinder wirklich glücklich machen? Können wir sie zwingen, wirklich freundlich zu sein?
Nein. Wir können unsere Kinder nicht dazu bringen, irgendetwas zu tun. Wir können sie küssen, lieben, umarmen und verwöhnen. Wir können sie für unzählige Aktivitäten anmelden, Spielverabredungen und Ferien planen, ihnen Musik- und Ballettunterricht und Fußballtraining ermöglichen und alles tun, um ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen für ihr zukünftiges Leben zu geben.
Aber denken Sie einen Moment darüber nach – ist dieses “Glück” wirklich das, wonach wir suchen?
Diese Reise, die wir als glückselige, oft überforderte Eltern haben, beginnt früh – unsere süßen kleinen Babys dürfen krähen, weinen, spucken und uns nachts aufwecken, bis sie etwa ein Jahr und 10 Monate alt sind. Dann haben wir, plötzlich und wie über Nacht, ein ganz neues Regelwerk für sie: Wir wollen, dass sie, zuhören, Regeln befolgen und “nett sind”.
Und gerade als wir unsere Erwartungen an unsere zum Kleinkind gewordenen Babys ändern, scheint die Hölle loszubrechen. Ein Schalter wird betätigt und unsere süßen Kleinen werden zu anspruchsvollen, irrationalen, sich in der Trotzphase befindenden Kleinkindern. Wir befürchten, dass, wenn wir jetzt nicht gegen ihr “schlechtes” Verhalten vorgehen, sie diese Verhaltensweisen für immer beibehalten.
- Mierau, Susanne (Autor)
Überraschenderweise sind es genau wir Eltern, die unbewusst und unbeabsichtigt ihren Kindern im Weg stehen, sich zu den einfühlsamen, belastbaren, glücklichen Kindern und Erwachsenen zu verwandeln.
Eltern denken oft, dass sie das Beste für ihre Kinder tun, obwohl sie in Wirklichkeit Bedürfnisse blockieren, die im Mittelpunkt dessen stehen, was die Persönlichkeit des Kindes ausmacht. Wenn wir diese Bedürfnisse im Keim ersticken oder gar übersehen, wenn wir versuchen, unsere Kinder zu formen, erdrücken wir sie. Wir verweigern ihnen die entscheidende Grundlage, die notwendig ist, damit sich die Kinder gut entwickeln und entfalten können.
Indem wir ihnen in die Quere kommen, können wir unbeabsichtigt die Entwicklung unserer Kinder sabotieren. Wir nehmen ihnen die Fähigkeit sich selbst zu verstehen, die Welt auf eine Weise zu erforschen, die für sie Sinn macht und ihre Neugierde fördert. Wir reduzieren ihre Motivation zum Lernen. Wir nehmen ihnen das Vertrauen, Beziehungen aufzubauen, und vor allem nehmen wir ihre Kompetenz, die emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln, die für ihren Erfolg in der Schule und im Leben notwendig sind.
Ich meine nicht, dass es uns gelingt, in der Art und Weise, wie wir heutzutage an Erfolg denken, erfolgreich zu sein: dass sie direkt – 1er Schüler, großartige Athleten, versierte Künstler oder die nächsten großen Geschäftsinnovatoren – werden, obwohl all das auch passieren könnte.
Was ich mit Erfolg meine, ist Folgendes: eine Person, die sich sicher fühlt, die Welt um sich herum mit Begeisterung und Neugierde zu erkunden, die keine Angst davor hat, Fehler zu machen, die sich sicher genug fühlt, um Freunde zu finden, und die sich gut gerüstet genug fühlt mit Enttäuschungen fertigzuwerden. Ein Mensch, der mit dem Leben umgehen kann, ist motiviert zu lernen, steht für sich selbst ein und kümmert sich um andere. Klingt das zu gut, um wahr zu sein?
- Brand: Beltz GmbH, Julius
- Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn: Der entspannte Weg durch Trotzphasen
- Produktart: ABIS_BOOK
- Farbe: Yellow
- Graf, Danielle (Autor)
Überhaupt nicht.
Kleinkinder tun oder sagen viele Dinge, die aus der Sicht eines Erwachsenen irrational oder gar absurd erscheinen. Tatsächlich verärgern uns Eltern viele der scheinbar unlogischen Entscheidungen unserer Kleinen.
Unsere Antwort?
Wir neigen dazu, sie zu schimpfen oder einfach zu stoppen. Als Erwachsene sehen wir die Trotzphase unserer Kleinkinder als Grund erzieherisch einzugreifen, weil sie so außer Kontrolle zu sein scheinen.
Wir sehen Kinder in diesem Alter als “Trotzköpfe”. Wir sagen sie befinden sich in der “Trotzphase”. Aber wenn man sie mit anderen Augen betrachtet, können diese Verhaltensweisen Sinn machen, auch für uns. Dann werden Sie in der Lage sein, Ihr Kind durch zu einer sozialeren Lebensweise zu führen. Irgendwann.
Was können Eltern also während der Trotzphase ihrer Kinder tun?
Es gibt 15 wichtige Möglichkeiten, wie Eltern mit ihrem Kleinkind während der Trotzphase interagieren können.
- Spiegeln Sie ein Gefühl der Sicherheit und der relativen Ordnung zurück.
- Hören Sie Ihrem Kind zu, statt es zu belehren und anzuleiten
- Geben Sie Ihrem Kind den Freiraum und die Zeit zum selbstständigen Spielen und Entdecken.
- Bieten Sie Ihrem Kind den Raum und die Möglichkeit, sich zu messen und zu scheitern.
- Arbeiten Sie daran, zu verstehen, was jedes einzelne Kind aus macht und was es in einem bestimmten Alter braucht.
- Den Kindern Möglichkeiten, Grenzen und Anleitung geben.
- Sobald der Zorn ausbricht, ist die Gefühlswelt des Kindes durcheinander. Es kann seine Emotionen noch nicht äußern, benötigt aber für den inneren Frust ein Ventil! Zum besseren Verständnis sollten Erwachsene dabei an Situationen denken, in denen ihnen auch etwas „über die Hutschnur“ gegangen ist.
- „NEIN, NEIN, NEIN!“ Das Kind ist auf contra und bleibt dabei, bis sich der Zustand entspannt. Eltern dürfen das „NEIN“ nicht persönlich nehmen oder gar als Angriff sehen. Der Nachwuchs baut nur seine Autonomie aus, will aber keinesfalls familiären Unfrieden. Solche Kontroversen sind vollkommen normal.
- Panik im Supermarkt: Das Kind ist müde, vielleicht noch etwas hungrig und die Prozedur des Einkaufens verläuft schleppend. Kurz vor der Kasse sieht es Süßigkeiten und stößt auf den berechtigten Widerstand der Mutter/Vater. Blitzschnell schlägt die Stimmung um. Aus dem kleinen Engel wird ein Wüterich, der sich tobend auf dem Erdboden wälzt.
Ein Albtraum, zumal rasch mitleidige Blicke oder gute Ratschläge vom umstehenden Publikum folgen!
Ruhe bewahren, am besten von 10 (20, 30) rückwärts zählen und die Situation entschärfen. Nicht dem öffentlichen Druck nachgeben und die Nascherei kaufen, sondern notfalls das Kind heraustragen. - Konsequent bleiben! Reagieren Eltern in Ausnahmesituationen mit neuen Verboten oder Regeln, verwirrt es den Nachwuchs noch viel mehr. Mitten im Chaos besteht kein Diskussionsbedarf!
- „Alleine!“, „Selber!“ – An- und Ausziehen wird zur Geduldsprobe, dabei ist der Nachwuchs so stolz auf seine Fähigkeiten. Mütter und Väter bestehen diese Prüfung, wenn sie von vornherein mehr Zeit einplanen. Das Kind kann sich ausprobieren und falls es Hilfe braucht, greifen erwachsene Hände schnell ein.
- Veränderungen ankündigen! Kinder brauchen ein verlässliches (Tages)Gerüst. Ändern Erwachsene immer wieder ihre Versprechen und Aussagen, sind sie verstört und entrüstet. Kleinkinder äußern ihren Verdruss mit Wut.
- Schläge sind tabu! Weiß der Nachwuchs mit seinen Aggressionen nicht wohin, erhebt er gerne die Hand. Das darf er auch tun, aber nur auf Kopfkissen oder Matratzen.
- Wut ist ein natürliches Gefühl! Inmitten des Zustandes ist man nicht mehr Herr der Lage. Gut, wenn Eltern einen kühlen Kopf bewahren und alles im Griff haben. Kinder besitzen feine Antennen und merken genau, ob Eltern Souveränität und Besonnenheit besitzen.
- Ignorieren, allenfalls durch räumliche Trennung! Mit etwas Abstand sieht die Sache schon ganz anders aus.
Diese einfachen Handlungen geben jedem Kind eine stabile Basis, um in einer Zeit zu wachsen, in der es gerade erst anfängt, sich selbst in Bezug auf andere zu testen und zu verstehen und auf seine komplizierten Gefühle während der Trotzphase zu reagieren und sie zu managen.
Experten raten entnervten Eltern, das negative Gefühl der Wut positiv zu sehen. Warum?
- Wut fördert den eigenen Willen. Kinder sollen sich behaupten, Entscheidungen treffen und die Konsequenzen in Betracht ziehen.
- Wut ist eine Belastungsprobe. Äußerlich und innerlich steht das Kind unter Hochspannung. Tränen und Gebrüll sind ein Ventil, um diese Spannungen auszuhalten. Gebräuchliche Tröster wie Schokolade oder Spielzeug lenken nur ab, begünstigen Verdrängungsmechanismen.
- Wut vermittelt: So wie ich bin, hat mich meine Familie lieb.
- Wut schult soziale Kompetenz. Inmitten von Unmut und Rage lernen sich Kinder und Eltern wirklich kennen.
- Wut und Sprache. Sobald das kleine Kind sich hinreichend ausdrücken kann, fallen Trotzanfälle gemäßigter aus. Stehen ihm nicht so viele Wörter zur Verfügung, bleibt nur eine extreme Reaktion. Generell gilt: Je mehr Mädchen und Jungen sprechen, umso differenzierter ihre Gefühls- und Gedankenwelt.
- Wut durch Hormonchaos. Im dritten Lebensjahr sorgt veränderter Stoffwechsel für Stimmungsschwankungen. Kinder ermüden schneller, lassen in der Konzentration nach und sind launenhaft. Eben noch frech wie Oskar, will das Kind kuscheln und sucht Nähe.
Kinderpsychologen bezeichnen die Trotzphase als „kleine Pubertät“. Sie ist ein Vorgeschmack auf den Abnabelungsprozess im Teenageralter. Dann werden sich geistesgegenwärtige Eltern verklärt an ihre Kleinkinder erinnern, schmunzelnd Begebenheiten erzählen und versuchen einen „echten“ Kaktus zu umarmen.

Hinweis: *Affiliatelink, als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Preis kann abweichen, inkl. MwSt., zzgl. Versand, Letzte Aktualisierung am 25.04.2024 um 19:11 Uhr / Bilder von der Amazon Product Advertising API

 Alleinerziehend auf Partnersuche
Alleinerziehend auf Partnersuche

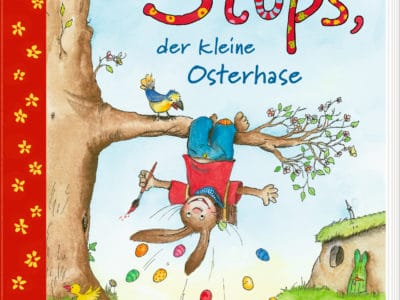


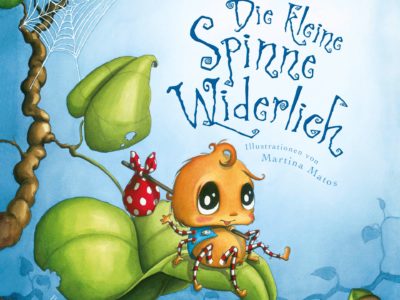

Schreibe einen Kommentar